Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
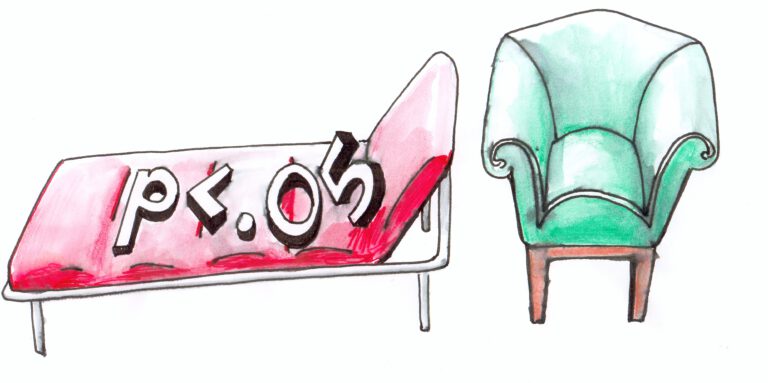
Unser Verein hat mit großer Vorfreude und vielen Erwartungen diese Tagung in Köln organisiert. Die Idee dahinter war, die derzeitige Stellug der Psychoanalyse an Universitäten und in der Lehre zu beleuchten und zu hinterfragen. Wir haben uns besonders auf den Austausch zwischen Studierenden und Praktizierenden gefreut, insbesondere die Motivation und Haltung der Studierenden zum Thema Psychoanalyse. Ebenso motivierte uns die Fragestellung, wie sich Psychoanalytiker und Verbände in das Vorhaben einbringen können, die Psychoanalyse an den Universitäten wieder stark zu machen.
Wie sich herausstellte, offenbarte die an die Tagung anschließende Diskussion die defizitäre Situation und Gestaltung des Studiengangs Psychologie, bemerkte man doch eine Unzufriedenheit mit der derzeitigen Lehre und die Notwendigkeit psychoanalytischer Inhalte aufgrund der häufigen an das Studium anschließende Berufswahl des Psychotherapeuten. Eine einseitige verhaltenstherapeutisch-orientierte Lehre erschien allen Anwesenden als nicht erstrebenswert, schließt sie doch wichtige und der Psychologie eigene Konzepte aus.
Für die Personen, die nicht teilnehmen konnten, haben wir Video- und Audio-Mitschnitte erstellt.
Wir möchten uns noch einmal bei allen Rednern und Besuchern herzlich für ihre Beiträge bedanken und hoffen, Sie und Euch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen!

mit Univ.-Prof. Dr. Matthias Kettner
Professor für praktische Philosophie und Dekan der Fakultät für das Studium Fundamentale, Universität Witten-Herdecke
Der erste Vortrag am Morgen unserer Tagung von Prof. Dr. Kettner schaffte es unser Tagungsthema einzuleiten. Es wurde die derzeitige Situation der Psychoanalyse an Universitäten verdeutlicht und auf ihre Wichtigkeit im Hinblick auf die Vielfältigkeit der Lehre im Bereich Psychologie sowie ihre Verankerung im Alltagsleben hingewiesen. Weiterhin gehöre neben der akademischen Bildung auch die Persönlichkeitsbildung zu einer Aufgabe, die Universitäten leisten sollten. Schon Freud sagte, dass die Psychoanalyse als Therapie nicht das Wichtigste sei, die Psychoanalyse biete viel mehr als das. Die Psychologie des Unbewussten sei eher ein Teil der Psychologie. Laut Prof. Dr. Kettner sind Menschen „sinnbildende Wesen“ und verdeutlichte, dass ein spezifisches Menschenbild nicht in jedem Fachbereich übereinstimmen müsse, um bestehen zu dürfen. Ein „sinnbildendes Wesen“ könne mit der Konflikttheorie der Psychoanalyse verknüpft werden, welche von keinem anderen Bereich übernommen würde.
Prof. Dr. Kettner verdeutlichte, dass psychoanalytische Begriffe bereits im allgemeinen Sprachgebrauch verankert, und typische Schlagworte dadurch trivialisiert seien. Die Universität habe die Aufgabe, dieses triviale Allgemeinwissen wieder „scharf zu stellen“. Als weiterer elementarer Grund für die Integration der Psychoanalyse an den Universitäten nannte Prof. Dr. Kettner die Persönlichkeitsbildung, die aufgrund der derzeitigen universitären Struktur in den privaten Bereich abgeschoben würde. Die Persönlichkeitsbildung sei in diesem Lebensabschnitt von großer Bedeutung und gehörte seit jeher zur akademischen Bildung. Besonders die Psychoanalyse biete Möglichkeiten, mit denen es sich „besser leben“ könne, sie leiste mehr als andere Psychologien. Die Universität solle die Anforderung an sich selbst haben, eine Reflexion auf das „gute und richtige Leben“ einzuschließen. Der Schlüsselbegriff „Selbstreflexionsfähigkeit erweitern“ sei zentral und eine genuine Leistung der Psychoanalyse, die kein derartiges Äquivalent besäße.
Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Kettner für diesen anregenden Vortrag!
mit Dr. med. Heribert Blaß
Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychoanalytiker (DPV)
Schon in der Diskussion des ersten Vortrags war deutlich geworden, dass die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Psychoanalyse von immenser Bedeutung für ihr Verhältnis zur universitären Psychologie ist. Herr Dr. Blaß zeigte in seinem folgenden Vortrag über „Das Wissenschaftsverständnis der Psychoanalyse“, dass dieses Konfliktfeld die Psychoanalyse seit ihrer Entstehung prägt. Während im psychoanalytischen Diskurs immer wieder die positivistische Position, die Psychoanalyse sei nicht wissenschaftlich und dürfe nicht an die Universität, und die orthodoxe Position, die Psychoanalyse sei quasi autonom und die Universität dürfe nicht an sie, bezogen wurden, suchten heutige Autoren zunehmend nach einem dritten Standpunkt. Dieser beinhalte die Verknüpfung quantitativer und qualitativer Forschung und gehe die Mängel der Untersuchungen auf Gruppenebene ebenso an wie die der narrativen Fallstudien.
Wir sind Herrn Dr. Blaß dankbar für den tiefgehenden Blick in die psychoanalytische Forschung – und für einen optimistischen in die Zukunft.
mit Prof. Dr. phil. Martin Teising
Präsident der International Psychoanalytic University, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Psychosomatik, Psychoanalytiker und ehemaliger Vorsitzender der DPV
Herr Professor Teising begann seinen Vortrag mit einer überraschenden Beobachtung. Dass Werbung für die International Psychoanalytic University, deren Präsident er ist, doch nicht das Ziel seines Vortrags sein sollte und wir keine Flyer auslegen wollten, schien ihm ein Symptom für den grundlegenden Konflikt in der Haltung zur IPU. Auch in unserem Verein vermutete er daher zwei Lager: Eines, das die Privatuniversität IPU als Chance für die Psychoanalyse begreife, und eines, das in der IPU den endgültigen Rückzug der Psychoanalyse aus den staatlichen Universitäten sehe. Wäre aber eine dritte Position, die die IPU als notwendige Ergänzung angesichts der universitären Verdrängung der Psychoanalyse begrüße, nicht langfristig für alle Seiten die beste Lösung? Die Frage, welche Möglichkeiten staatliche Universitäten im Hinblick auf eine bessere Integration der Psychoanalyse haben und leisten sollten, blieb in diesem Kontext leider unbeantwortet.
Wir danken Herrn Professor Teising für die Anregung, diese spannenden Fragen am Beispiel der International Psychoanalytic University kritisch zu diskutieren.
mit Dipl.-Psych. Christa Leiendecker
Psychologische Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin (DPV)
Frau Leiendecker erörterte in ihrem Vortrag die enge Interdepedenz von klinischer Psychoanalyse und analytischer Kulturtheorie anhand eines historischen Rückblicks auf ihre Entwicklung in Deutschland. Die gesellschaftliche Rezeption der Psychoanalyse und die Implementierung als Wissenschaft an Universitäten, sowie als klinische Heilmethode sei auch stark von den jeweils herrschenden gesellschaftlichen und insbesondere politischen Verhältnissen abhängig.
Laut Frau Leiendecker muss die Psychoanalyse an Universitäten wieder umfassend gelehrt werden um das Menschenbild der Psychoanalyse wieder in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs und auch in die gesellschaftlichen Vorstellungen über das kranke Subjekt und dessen mögliche Heilung zu bringen. Hierfür nannte sie weiterhin die Notwendigkeit ihrer Beforschung um als klinische Behandlungsmethode innerhalb des Gesundheitssystems weiterhin qualifiziert zur Verfügung zu stehen.
Wir danken Frau Leiendecker für diesen spannenden Vortrag und ihre Fürsprache.
mit Dr. Rupert Martin
Psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker (DPV)
Dr. Martins Studie war eingebettet in ein größeres Projekt (Development Psychoanalytic Practice and Training – DPPT), das von der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung 2004 ins Leben gerufen wurde, um den Rückgang der Bewerberzahlen für die psychoanalytische Ausbildung zu untersuchen. Dr. Martin beschäftigte sich darin mit der Frage, was Psychologie-Studierende motiviert Psychotherapeut zu werden und was die Wahl einer psychodynamischen Therapieausbildung bestimmt.
In den vielen Interviews, die Dr. Rupert Martin gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Michael Koenen über mehrere Jahre mit Ausbildungskandidaten geführt haben, traten deutliche Unterschiede zwischen den therapeutischen Schulen hervor. So wollte kaum einer der verhaltenstherapeutischen Kandidaten die Narration seines Interviews, die auch den in mehreren Prozessen herausgearbeiteten unbewussten Gehalt enthielt, zur Veröffentlichung freigeben, obwohl sie sie ebenfalls für zutreffend hielten. Auch waren eine besonders intensive Beschäftigung mit dem eigenen Werdegang und eine stark ausgeprägte Berufsidentität eher bei den Kandidaten der psychodynamischen Ausbildungen zu finden, während die angehenden Verhaltenstherapeuten in der Regel sehr viel nüchterner und pragmatischer mit ihrer Berufswahl umgingen. Die Studie zeigt uns zwar, wie wichtig eine Neigung zur Selbstreflektion als Voraussetzung für das Interesse an Psychoanalyse ist – aber auch vor allem, dass die universitäre Lehre häufig der wichtigste Einfluss auf die Wahl der therapeutischen Schule ist.
Wir danken Dr. Rupert Martin für eine spannende Auseinandersetzung mit der psychotherapeutischen Berufsidentität.



Beitrag über die Veranstaltung von Dr. med Sönke Behnsen